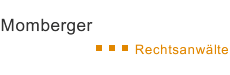Mietrecht
Mietrecht
Nach inzwischen gefestigter BGH-Rechtssprechung hat der Vermieter den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten. Diese vertragliche Nebenpflicht des Vermieters bedeutet, dass der Vermieter bei jeder kostenauslösenden Maßnahme das Kostennutzenverhältnis beachten muss. Sollte sich zum Beispiel der Abschluss eines Wärmelieferungsvertrages im Vergleich zur vorher bestehenden Heizung als teurer herausstellen, weil ggf. durch die erforderlichen Umbauarbeiten eine Modernisierungsmieterhöhung notwendig wird, kann es sein, das der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz verletzt ist. In einem aktuellen Fall hat der BGH entschieden (Urteil v. 28.11.20007, AZ VIII ZR 243/06), das der Vermieter bei allen Entscheidungen die Einfluss auf der Höhe der Nebenkosten haben, als vertragliche Nebenpflicht den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz zu beachten hat. In dem zu entscheidenden Fall hatte der Vermieter die Wärmeversorgung mit einem Contractor auf 15 Jahre fest vereinbart. Der Mieter war der Ansicht, dass der Vermieter einen unwirtschaftlichen Vertrag eingegangen ist, weil auch durch die lange Vertragsbindung eine flexible Reaktion auf günstigere Anbieter nicht möglich sei. Außerdem hatte der Mieter vorgetragen, dass die Entgeltvereinbarung mit dem Contractor unangemessen hoch sei.
Für die Vermieter positiv an dieser Entscheidung ist, das der BGH klargestellt hat, das zwar grundsätzlich bei Verletzung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes ein Schadensersatzanspruch des Mieter auf Freihaltung der unnötigen Kosten gegeben sein kann, die vertraglich Rücksichtnahmepflicht greift allerdings erst für Verträge nach Abschluss des Mietvertrages ein. Da in dem zu entscheidenden Fall das Mietverhältnis erst nach Abschluss des Wärmelieferungsvertrages eingegangen worden war, konnte sich der Mieter nicht erfolgreich auf eine mögliche Verletzung des Wirtschaftlichkeitsgrundsatz berufen.
Regelmäßig im letzten Drittel des Jahres werden die Betriebskostenabrechnungen an die Mieter versandt. Teilweise erfolgt die Erstellung der Abrechnung in Zeitnot und nicht selten werden Abrechnungen zu spät zugestellt. Die häufigsten Streitpunkte sind bei der Betriebskostenabrechnung:
• die Belegüberlassung,
• der Ansatz von Zwischenablesungen,
• Mietvertragsausfertigungsgebühren,
• die Umlage der Aufzugskosten für den Erdgeschossmieter,
• die Abrechnung von Leerstand,
• die Abgrenzung bei gemischt genutzten Gebäuden.
Weiterführende Informationen finden Sie hier:
1. Der gesetzliche Grundgedanke
2. Die Vereinbarung
3. Betriebskosten Begriff
4. Verteilerschlüssel
5. Die Abrechnung
6. Korrektur der Betriebskostenabrechnung
7. Umlage neuer Betriebskosten
8. Kontrollmöglichkeiten des Mieters
9. Betriebskosten im Vergleich
10. Die Energieeinsparverordnung
11. Urteile
Mieter haben die Möglichkeit, die Betriebskostenabrechnung zu überprüfen. Von dieser Möglichkeit sollte auf jeden Fall Gebrauch gemacht werden.
Der Mieter hat Anspruch auf Einsichtnahme in Original-Belege; Computerausdrucke oder eingescannte Belege reichen nicht.
Mieter preisfreien Wohnraums haben keinen Anspruch auf Kopien der Belege; die Einsichtnahme in die Belege erfolgt in der Regel am Ort des Mietobjekts.
Merkpunkte:
• Mieter haben Anspruch auf Einsichtnahme in Betriebskostenbelege im Original.
• Ein Anspruch auf Überlassen von Kopien besteht regelmäßig nicht.
• Bei der Einsichtnahme kann der Mieter sich von rechtskundigen und mit der Abrechnung erfahrenen Personen vertreten lassen;
• der Vermieter schuldet keine Erläuterung, wohl aber eine geordnete Zusammenstellung.
Lange Zeit war umstritten, ob der Mieter auch einen Anspruch auf Kopien der Abrechnungsbelege geltend machen konnte. Gerade die Mietervereine haben regelmäßig Termine zur Einsichtnahme abgelehnt und die Übersendung von Fotokopien gefordert. Nun hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 08. März 2006 entschieden, dass dem Mieter preisfreien Wohnraums grundsätzlich kein Anspruch gegen den Vermieter auf Überlassung von Fotokopien der Abrechnungsbelege zusteht (Az.: VIII ZR 78/05).
Diese Entscheidung wurde mit einem weiteren Urteil vom 13.09.2006 (AZ.: VIII. ZR 105/06) nochmals im Grundsatz dahingehend bestätigt, dass ein Anspruch des Mieters auf Übermittlung von Fotokopien der Rechnungsbelege zur Betriebskostenabrechnung aus Gründen von Treu und Glauben nicht in Betracht kommt, wenn ihm in zumutbarer Weise Einsichtnahme in die der Betriebskostenabrechnung zu Grunde liegenden Abrechnungsbelege angeboten wurde. Etwas anderes könne nur dann gelten, wenn dem Mieter ausnahmsweise die Einsichtnahme in die Abrechnungsunterlagen in den Räumen des Vermieters nicht zugemutet werden könne. Für viele Mieter- und Vermietervereine wird damit die Überprüfung der Betriebskostenabrechnung aufwendiger, weil nunmehr regelmäßig davon auszugehen ist, dass eine Einsichtnahme vor Ort erforderlich ist.
Selbst eine Übersendung einiger Belegkopien aus Gefälligkeit führt nicht dazu, dass der Mieter danach einen Anspruch auf weitere Belegkopien erhält (BGH Urteil v. 13.09.2006, Az.: VIII. ZR 71/06).
Etwas anderes kann nach Ansicht des Amtsgerichts Mainz (Urteil vom 21.09.2006, Az.: 86 C 149/06) nur dann gelten, wenn der Vermieter dem Mieter die Zusage gegeben hat, auf Verlangen entsprechende Kopien von Abrechnungsbelegen zur Verfügung zustellen. Eine entsprechende Vereinbarung kann dabei ihm Mietvertrag getroffen werden, aber auch später mündlich oder schriftlich erfolgen. Ist im Mietvertrag keine Regelung getroffen, wird dem Mieter aber eine entsprechende Zusicherung gegeben, so handelt es sich um ein Schuldanerkenntnis, aus dem heraus der Mieter die Kopien von Abrechnungsbelegen verlangen kann.
Neben der Übersendung von Belegkopien ist im Rahmen der Einsichtnahme durch das Landgericht Berlin (Urteil vom 28.09.2006, Az.: 67 S 225/06) in der Berufungsinstanz geklärt worden, dass die Einsichtnahme in Abrechnungsunterlagen zur Betriebskostenabrechnung bereits dann gewährt wird, wenn der Vermieter dem Mieter einen Aktenordner mit Belegen in seinen Geschäftsräumen vorlegt und es dem Mieter gestattet, sofern erforderlich auch eine fachkundige Person zur Einsichtnahme hinzuzuziehen, damit sich der Mieter in den Belegen zurecht finden kann.
In dem zu entscheidenden Fall hat der Mieter geltend gemacht, dass ihm eine Einsichtnahme in die Betriebskostenbelege dadurch verweigert worden sei, dass anlässlich der Einsichtnahme in den Geschäftsräumen des Vermieters niemand vor Ort gewesen sei, der dem Mieter die Abrechnung habe erklären können. Das Landgericht Berlin hat dazu entschieden, dass dem Mieter ausschließlich das Recht zusteht, Einsicht in die Belege zu nehmen. Der Vermieter muss nicht zur Verfügung stehen, um dem Mieter Erläuterungen zum Inhalt der Belegkopien zugeben. Hierbei darf sich der Mieter fachkundiger Hilfe bedienen.
Grundsätzlich sollte jeder Mieter daher frühzeitig nach Erhalt der Betriebskostenabrechnung möglichst mit Hilfe fachkundiger Personen die Belege zur Betriebskostenabrechnung einsehen und sich entsprechende Notizen im Falle von Abweichungen zwischen Belegen und der Abrechnung machen. Da der Mieter andernfalls in einem Gerichtsverfahren nicht konkret vortragen kann, ist er ohne Belegeinsichtnahme mit allen seinen Einwendungen ausgeschlossen.
Aus Vermietersicht bietet es sich danach an, die Termine zur Einsichtnahme in die Betriebskostenbelege bereits in der Abrechnung auf einen bestimmten Zeitraum zu begrenzen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Einsichtnahme kontrolliert abläuft und alle Belege noch vorhanden sind; schließlich müssen die Belege regelmäßig auch steuerlich erfasst werden und stehen während dieser Zeit nicht zur Einsichtnahme zur Verfügung. Dazu ist es höchstrichterlich noch nicht geklärt, ob eine wirksame Begrenzung der Belegeinsichtnahmefrist dazu führt, dass der Vermieter die spätere Belegeinsichtnahme verweigern kann.
Die Mietvertragsparteien sind grundsätzlich darin frei, die Art der Betriebskostenüberbürdung zu bestimmen. Die Pflicht zur Übernahme der Betriebskosten kann dabei - vorbehaltlich der Heizkosten - als Pauschale oder als Betriebskostenvorauszahlung vereinbart werden. Je nachdem, welche Variante vereinbart wurde, spricht man entsprechend den umfassten Betriebskosten von Inklusivmiete, Bruttowarmmiete, Nettomiete, Nettowarmmiete, Teilinklusivmiete oder Brutto- bzw. Nettokaltmiete.
a) Pauschale
Angesichts stets steigender Betriebskosten ist die Vereinbarung einer monatlichen Pauschale eher der Ausnahmefall. Die Vereinbarung einer Pauschale für die Heizkosten ist zudem nach der Heizkostenverordnung unzulässig. Ist eine Pauschale wirksam vereinbart, spricht man von einer so genannten Inklusivmiete oder Teilinklusivmiete, je nachdem, ob einzelne Betriebskosten aus der Pauschale herausgenommen wurden oder ob die pauschale Zahlung alle Betriebskostenarten umfasst.
b) Betriebskostenvorauszahlungen
Die geläufige Variante ist die Vereinbarung von Betriebskostenvorauszahlungen. Der Mieter erbringt dabei gewissermaßen einer à conto Leistung auf die der Höhe nach noch nicht feststehenden Betriebskosten. Nach der gesetzlichen Grundkonzeption ist der Vermieter in diesem Fall verpflichtet, über die Vorauszahlungen abzurechnen. Für Wohnraummietverhältnisse sieht § 556 BGB eine jährliche Abrechnung vor.
c) Inhalt der Vereinbarung
Da der Mietvertrag die Grundlage für eine Überbürdung der Betriebskosten auf den Mieter bildet, sind in diesem auch die vom Mieter zu tragenden Betriebskosten aufzuführen. Dabei gilt, dass eine exakte Vereinbarung nicht nur der Rechtsklarheit dient, sondern auch Änderungen in der Rechtsprechung vorbeugt. Für Vermieter empfiehlt sich daher, den Text der Betriebskostenverordnung dem Mietvertrag beizulegen.
Die frühere Rechtsprechung hat verlangt, dass die Vereinbarung die Betriebskosten exakt aufführte. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main (Beschluss v. 10.5.2000, 20 ReMiet 2/97, GE 2000, S. 890) sind Betriebskosten heutzutage jedem Mieter ein Begriff, sodass mittlerweile jeder Durchschnittsmieter den Kernbereich und die Tragweite der Betriebskostenvereinbarung kennt. Um Streitigkeiten und Unklarheiten zu vermeiden, sollte dabei zumindest auf die Betriebskostenverordnung verwiesen werden, weil dies auch der Klarstellung dient und Streit um die Betriebskosten vermeiden hilft.
Werden im Mietvertrag die vom Mieter zu tragenden Betriebskosten nicht einzeln aufgeführt, sondern durch einen Verweis auf gesetzliche Regelungen vereinbart, muss auf die jeweils gültigen Verordnungen verwiesen werden.
Führt der Vermieter die Betriebskosten nicht einzeln im Mietvertrag auf, reicht auch ein Verweis auf die seit dem 01.01.2004 gültige Betriebskostenverordnung.
Wird aber in einem nach dem 01.01.2004 geschlossenen Mietvertrag formularvertraglich auf die II. Berechnungsverordnung verwiesen, ist die Betriebskostenüberbürdung unwirksam
Besonderes Augenmerk ist dabei auf die „Sonstigen Betriebskosten“ zu legen.
Zwar hat das Oberlandesgericht Hamm lediglich den bloßen Hinweis auf die Anlage 3 zu § 27 der II. Berechnungsverordnung (seit 1.1.2004 auf die Betriebskostenverordnung) genügen lassen (RE v. 22.8.1997 – 30 RE-Miet 3/97, WM 1997, S. 543) sollen aber „Sonstige Betriebskosten“ vereinbart werden, ist dies nicht von der II. Berechnungsverordnung bzw. der Betriebskostenverordnung umfasst. Diese Betriebskosten müssen einzeln aufgeführt und vereinbart werden
Merkpunkte:
Es gilt also:
• Die Grundlage für eine Überbürdung der Betriebskosten auf den Mieter bildet der Mietvertrag!
• Eine exakte Übertragung ist unbedingt erforderlich.
• Die frühere Rechtsprechung hat verlangt, dass die Vereinbarung die Betriebskosten exakt aufführte.
• Seit dem Urteil OLG Hamm,v. 22.08.1997 ist dies nicht mehr erforderlich. Ein Hinweis auf die heute gültige Betriebskostenverordnung reicht daher aus.
• Eine exakte Vereinbarung dient aber der Rechtsklarheit und beugt Änderungen in der Rechtsprechung vor. Es empfiehlt sich daher, den Text der Betriebskostenverordnung dem Mietvertrag beizulegen;
• die „Sonstigen Betriebskosten“ müssen definiert werden!
Das AG Konstanz hat ein formular-vertragliches Tierhaltungsverbot für unwirksam erklärt, in welchem der Vermieter sich eine schriftliche Einwilligung in die Tierhaltung vorbehalten hatte (AG Konstanz, WuM 2007, 355). Nach Ansicht des Amtsrichters erweckt das Schriftformerfordernis unzulässigerweise den Eindruck, dass eine mündliche Erlaubnis unwirksam sei. In dem gleichen Verfahren wurde noch einmal bestätigt, dass das Verbot der Haltung von Kleintieren ebenfalls unwirksam ist.