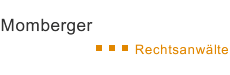Rechtsthemen
Rechtsthemen
Lohnt es sich überhaupt, für eine Anwältin oder einen Anwalt Geld auszugeben?
Können Sie durch den Rat eines Rechtsanwalts einen aussichtslosen Prozess vermeiden, durchaus. Obsiegt man in einem Prozessmit anwaltlicher Hilfe, so wird die Gegenseite meist zur Kostenerstattung verpflichtet. Besteht eine eintrittspflichtige Rechtsschutzversicherung, werden die Kosten übernommen. Der Rechtsanwalt ist gesetzlich dazu verpflichtet, unnötige Kostenrisiken für seinen Mandanten zu vermeiden und ihn entsprechend zu beraten. Ist das Honorar des Rechtsanwalts vom Gegenstandswert abhängig, muss der Anwalt seinen Mandanten hierüber informieren.
Sind Anwaltsgebühren gesetzlich geregelt?
Ja, im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Hier wird unterschieden zwischen Festgebühren und Rahmengebühren. Festgebühren fallen meist für gerichtliche Tätigkeiten im Zivilrecht an. Rahmengebühren sieht das Gesetz überwiegend für außergerichtliche
Tätigkeiten sowie weitgehend für die Gebiete des Straf- und Sozialrechts vor. Die Gebührentatbestände sind im Vergütungsverzeichnis als Anlage zum § 2 Abs. 2 RVG aufgelistet und mit den entsprechenden
gesetzlichen Gebührenvorschriften versehen.
Was kosten zivilrechtliche Angelegenheiten?
Dies bemisst sich nach dem Gegenstandswert und der auftragsgemäß entfalteten Tätigkeit. Unter dem Gegenstandswert einer Angelegenheit versteht man den objektiven Geldwert oder das wirtschaftliche Interesse des Auftraggebers. Bei Forderungsangelegenheiten entspricht er dem Betrag der geltend gemachten oder abzuwehrenden Forderung.
Bei nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten (z.B. negative Bewertung bei eBay) ist der Gegenstandswert der Rechtssprechung zu entnehmen. Im gerichtlichen Verfahren wird er vom Gericht festgesetzt. Dem jeweiligen Gegenstandswert ist eine feste Gebühreneinheit zugeordnet. Diese nennt man kurz „Gebühr“.
Gegenstandswert bis .... EUR Gebühr in EUR
| 300 |
25 |
| 600 |
45 |
| 900 |
65 |
| 1 200 |
85 |
| 1 500 |
105 |
| 2 000 |
133 |
| 2 500 |
161 |
| 3 000 |
189 |
| 3 500 |
217 |
| 4 000 |
245 |
| 4 500 |
273 |
| 5 000 |
301 |
| 6 000 |
338 |
| 7 000 |
375 |
| 8 000 |
412 |
| 9 000 |
449 |
| 10 000 |
486 |
| 13 000 |
526 |
| 16 000 |
566 |
| 19 000 |
606 |
| 22 000 |
646 |
| 25 000 |
686 |
| 30 000 |
758 |
Wir ein Auftrag zur Führung eines Gerichtsprozesses erteilt, so erhält der Rechtsanwalt für die erste Instanz bis zu 3,5 Gebühren, berechnet nach dem jeweiligen Streitwert, den das Gericht festsetzt. Welche Art von Gebühren anfallen, hängt von bestimmten Voraussetzungen ab. Folgende Gebühren können entstehen:
1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG
1,2 Terminsgebühr für die Wahrnehmung von Terminen gem. Nr. 3104 VV RVG
1,0 Einigungsgebühr, Nrn. 1000, 1003 VV RVG für die Mitwirkung des Anwalts an einem Vertrag, durch den der Streit beigelegt wird
Diese Gebühren fallen in jeder Instanz an. Im Berufungsverfahren erhöht sich
die Verfahrensgebühr auf 1,6
die Terminsgebühr bleibt bei 1,2.
die Einigungsgebühr beträgt 1,3.
Für die Vertretung mehrerer Auftraggeber erhöht sich die Geschäftsgebühr bzw. die Verfahrensgebühr um 0,3 für jede weitere Person.
Die außergerichtlich entstandene Geschäftsgebühr wird auf die gerichtliche Verfahrensgebühr nur zur Hälfte, max. mit 0,75 angerechnet. Wenn der Anwalt zuerst außergerichtlich und dann gerichtlich in derselben Angelegenheit tätig wird, muss der Mandant also neben den Gebühren für die gerichtliche Tätigkeit nur einen Teil der Geschäftsgebühr für die außergerichtliche Tätigkeit zahlen. Neben den jeweiligen Gebühren erhält der Anwalt für seine Auslagen eine Auslagenpauschale von max. 20,- Euro. Außerdem muss die jeweilige Mehrwertsteuer berechnet werden, die an das Finanzamt abgeführt wird. Wenn Sie den Prozess gewinnen, muss der Verlierer diese Kosten erstatten.
Bei Erteilung eines Mandates ist der Auftraggeber vorleistungspflichtig. D. h., dass der Rechtsanwalt erst tätig wird, wenn die Gebühren zunächst durch den Auftraggeber beglichen worden sind.
Metatag - Verletzung des Kennzeichenrechtes eines Unternehmens durch Verwendung des Kennzeichens als sog. Metatag (BGH Urteil vom 18.Mai 2006, Az.: I ZR 183/03)
Die rasante Entwicklung des Internets als Informations- und Handelsportal hat gleichzeitig seine enorme Bedeutung als Werbemedium hervorgebracht. Damit verbunden sind vielerlei rechtliche Probleme. Um diese zu lösen, sind oftmals Gesetze heranzuziehen, die bereits längst in Kraft getreten waren, bevor das Internet überhaupt ins Bewusstsein der Bevölkerung rückte. Für moderne und Interessen ausgleichende Lösungen ist daher die Rechtsprechung der Gerichte unerlässlich. Sie liefert gleichsam das „Salz in der Suppe“ und soll nachfolgend zu einigen wesentlichen Fragen dargestellt werden:
Schlagwort: Metatag
Was ist überhaupt ein Metatag? Metatags sind Informationen im Quelltext einer Internetseite, die von Suchmaschinen aufgefunden werden und zu einer entsprechenden Trefferanzeige führen können.
Unternehmen treten am Markt entweder unter ihrer Marke oder unter ihrer geschäftlichen Bezeichnung auf. Verwendet ein Unternehmen unberechtigt die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung eines anderen Unternehmens als sog. Metatag, so stellt dieses Verhalten eine Verletzung des Unternehmenskennzeichens und ggf. auch einen Wettbewerbsverstoß dar. Der BGH begründet diese Entscheidung damit, dass es für eine Verletzung des Kennzeichenrechts gerade nicht auf die Wahrnehmbarkeit des sog. Metatag für den durchschnittlichen Internetnutzer ankomme. Vielmehr sei die kennzeichenmäßige Benutzung bereits deshalb gegeben, weil das Ergebnis des Auswahlverfahrens mit Hilfe des Suchworts (Metatag) beeinflusst und der Nutzer auf diese Weise geradezu auf die entsprechende Internetseite geführt wird. Insbesondere die Verwendung fremder Unternehmenskennzeichen innerhalb einer Branche begründet die Gefahr, dass der Internetnutzer dieses Angebot allein aufgrund der Kurzhinweise nicht vom Angebot des eigentlichen Kennzeicheninhabers unterscheiden kann. Dabei ist es unerheblich, ob dieser Irrtum bei einer näheren Befassung mit der Internetseite des unberechtigten Kennzeichennutzers ausgeräumt werden kann. Zulässig kann die Verwendung eines fremden Kennzeichens aber dann sein, wenn ein Unternehmen sein Angebot mit den Angeboten anderer Wettbewerber auf seiner Internetseite vergleicht und dabei die Marken oder geschäftlichen Bezeichnungen der Wettbewerber anführt, die in den Vergleich einbezogen sind.
GEFAHR: Falls Sie fremde Marken oder Unternehmenskennzeichen als Metatag verwenden, um auf Ihre Internetseite hinzuweisen, drohen Ihnen neben einer Abmahnung und einem sich ggf. anschließenden Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz vor allem erhebliche Kosten.
Lassen Sie sich kostenlos ein individuelles Angebot zur schriftlichen Ausarbeitung Ihrer Anfrage zusenden. Sie erhalten für Sie kostenlos ein Angebot zum Preis, Umfang und Dauer der Bearbeitung. Klicken Sie hier!
Punkte in Flensburg
Punktestand im Verkehrszentralregister
Was passiert bei welchem Punktestand im Flensburger Punktekatalog? Allgemeine Informationen zum Punktestand in Flensburg. Wie erfahre ich meinen Punktestand in Flensburg? Wie baue ich Punkte in Flensburg ab?
Was passiert bei welchem Punktestand im Flensburger Punktekatalog?
* 1 bis 3 Punkte Keine Sanktionen
* 4 bis 8 Punkte Bei freiwilliger Teilnahme an Aufbauseminaren:4 Punkte Abzug
* 8 bis 13 Punkte Verwarnung und Hinweis auf freiwilliges Aufbauseminar
* 9 bis 13 Punkte Bei freiwilliger Teilnahme an Aufbauseminaren:2 Punkte Abzug
* 14 bis 17 Punkte Teilnahme an Aufbauseminar wird angeordnet
* 14 bis 17 Punkte Bei freiwilliger Teilnahme an verkehrspsychologischer Beratung:2 Punkte Abzug
* Ab 18 Punkte Führerschein wird entzogen
Allgemeine Informationen zum Punktestand in Flensburg
* Punkte können nur einmal in 5 Jahren abgebaut werden.
* Punkte bleiben, wenn keine anderen dazu kommen, 2 Jahre in der Kartei.
* Nähere Informationen erteilt das jeweils zuständige Straßenverkehrsamt.
* Eine Zeit lang war es möglich Punkte in Flensburg über Ebay auszutauschen aber inzwischen wird das von Ebay nicht mehr geduldet.
Wie erfahre ich meinen Punktestand in Flensburg?
Rund 7,1 Millionen Autofahrer und Verkehrssünder sind derzeit im Verkehrszentralregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg gespeichert. Also etwa jeder siebte der 49 Millionen Führerscheininhaber in Deutschland. Autofahrer können sich kostenlos über Ihren aktuellen Punktestand in der Flensburger Verkehrssünderkartei informieren. Dazu reicht ein formloses Schreiben zum Punkte abfragen an das Kraftfahrt-Bundesamt mit der Bitte um Auskunft aus dem "Verkehrszentralregister". Die Anfrage kann ausschließlich schriftlich, per Fax oder persönlich abgefragt werden, also nicht per eMail oder Internet. Dazu wird eine behördliche Identitätsbescheinigung bzw. eine amtlich beglaubigte Unterschrift oder eine Kopie des Personalausweises, des Passes oder des behördlichen Dienstausweises benötigt. Die Bescheinigung bekommt man z.B. bei der Gemeinde/Behörde des Wohnsitzes. Die Auskunft zum Punktestand ist kostenlos, die Faxnummer des Kraftfahrt-Bundesamtes lautet:04 61 / 3 16 16 50 oder 04 61 / 3 16 14 95
Die Straßenverkehrsämter werden vom Kraftfahrtbundesamt informiert, sobald ein Verkehrsteilnehmer acht oder mehr Punkte hat. Als Fahrer werden Sie darüber ebenfalls informiert (Gebühr 17,90 EUR + Auslagen). Ab 14 Punkten bekommen Sie eine Gebührenpflichtige Aufforderung (25,60 EUR + Auslagen) an einem speziellen Aufbauseminar Teilzunehmen. Punkte wegen einer Ordnungswidrigkeit werden nach zwei Jahren getilgt. Solche wegen Straftaten ohne Alkohol und Drogen dagegen nach 5 Jahren und Punkte für Straftaten im Zusammenhang mit Alkohol oder Drogen nach 10 Jahren. Vorraussetzung für die Löschung der Punkte:In der jeweiligen Frist dürfen keine neuen punkterelevanten Verkehrsverstöße angefallen sein. Hat der Kontostand in der Sünderkatei 18 Punkte erreicht, wird der Führerschein eingezogen.
Wie baue ich Punkte in Flensburg ab?
Wenn Sie Punkte in Flensburg haben, können Sie durch die freiwillige Teilnahme an Aufbauseminaren und verkehrspsychologischen Beratungen bis zu 4 Punkte abbauen. Die Teilnehmer können in Gruppengesprächen und durch eine Fahrprobe beweisen, dass ihre Mängel in der Einstellung zum Straßenverkehr und im verkehrssicheren Verhalten erkannt und abgebaut wurden.
Das AG Konstanz hat ein formular-vertragliches Tierhaltungsverbot für unwirksam erklärt, in welchem der Vermieter sich eine schriftliche Einwilligung in die Tierhaltung vorbehalten hatte (AG Konstanz, WuM 2007, 355). Nach Ansicht des Amtsrichters erweckt das Schriftformerfordernis unzulässigerweise den Eindruck, dass eine mündliche Erlaubnis unwirksam sei. In dem gleichen Verfahren wurde noch einmal bestätigt, dass das Verbot der Haltung von Kleintieren ebenfalls unwirksam ist.
Mietrecht - Sparbuch
Das Landgericht Dortmund hat sich mit Urteil vom 5.12.2006 (Az.: 1 S 23/06) zu der Einstufung einer im Rahmen der Übergabe eines Sparbuchs gezahlten Kaution als Verpfändung oder aber Abtretung des Auszahlungsanspruches geäußert. In dem zu entscheidenden Fall hatte der Mieter die Mietkaution auf ein eigenes Sparkonto eingezahlt. Dieses Sparkonto wurde ohne weitere Vereinbarung dem Vermieter in Form des Sparbuchs übergeben. Da der Mieter insolvent wurde, ließ der Insolvenzverwalter sich das Guthaben des Sparbuches auszahlen. Der Vermieter klagte gegen die auszahlende Bank, um die Kaution für nicht gezahlte Mieten verwenden zu können. Nun war zu entscheiden, ob es sich um eine Abtretung oder aber eine Verpfändung handelte. Das Landgericht Dortmund hat – wie auch die Vorinstanz - die Übergabe eines Sparbuchs ohne weitere Vereinbarung als Abtretung des Auszahlungsanspruches gegen die Bank gewertet. Damit konnte der Vermieter wegen der unzulässigen Auszahlung durch die Bank von dieser die Kaution einklagen, während bei einer bloßen Verpfändung das Pfandrecht im Zweifel wegen der Nichteinhaltung der erforderlichen Form untergegangen wäre. Rechtsanwalt Düsseldorf Mietrecht
Kaution zusätzlich zur Bürgschaft
Das OLG Bamberg hatte sich mit einem Sachverhalt auseinander zusetzen, bei dem der Vermieter zusätzlich zu einer hinterlegten Barkaution in Höhe von drei Monatsmieten eine Bürgschaft durch einen Dritten verlangt und erhalten hat. Nachdem der Mieter nicht mehr zahlte, nahm der Vermieter zunächst die Kaution in Anspruch und wollte sich sodann aus der Bürgschaft befriedigen. Dem hat das OLG Bamberg mit Urteil vom 09.03.2006 (Az.: 6 U 75/05) eine Absage erteilt. Zur Begründung führt das Gericht aus, dass die gesetzliche Maximalhöhe der Kaution auf drei Monatsmieten abschließend begrenzt ist. Auch durch eine zusätzliche Bürgschaft kann diese Begrenzung nicht umgangen werden.