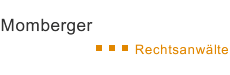Rechtsthemen
Rechtsthemen
Haben Sie Fragen zum Bußgeldkatalog, lassen Sie sich ein kostenloses, individuelles Angebot zur schriftlichen Ausarbeitung Ihrer Anfrage zusenden. Sie erhalten für Sie kostenlos ein Angebot zum Preis, Umfang und Dauer der Bearbeitung. Rechtsanwalt Verkehrsrecht
Bußgeldkatalog - Nummer 1 - 49
| Lfd. Nr. | Tatbestand | StVO | Regelsatz |
| in Euro, | |||
| Fahrverbot | |||
| in Monaten | |||
| A. Zuwiderhandlungen gegen § 24 StVG | |||
| a) Straßenverkehrs-Ordnung | |||
| Grundregeln | |||
| 1 | Durch Außer-Acht-Lassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt | § 1 Abs. 2 | |
| § 49 Abs. 1 Nr. 1 | |||
| 1.1 | einen anderen mehr als nach den Umständen unvermeidbar belästigt | 10 € | |
| 1.2 | einen anderen mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert | 20 € | |
| 1.3 | Einen anderen gefährdet | 30 € | |
| 1.4 | einen anderen geschädigt, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist | 35 € | |
| Straßenbenutzung durch Fahrzeuge | |||
| 2 | Vorschriftswidrig Gehweg, Seitenstreifen | § 2 Abs. 1 | 5 € |
| (außer auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen), | § 49 Abs. 1 Nr. 2 | ||
| Verkehrsinsel oder Grünanlage benutzt | |||
| 2.1 | - mit Behinderung | § 2 Abs. 1 | 10 € |
| § 1 Abs. 2 | |||
| § 49 Abs. 1 Nr.1 , 2 | |||
| 2.2 | - mit Gefährdung | 20 € | |
| 3 | Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen durch Nichtbenutzen | ||
| 3.1 | der rechten Fahrbahnseite | § 2 Abs. 2 | 10 € |
| § 49 Abs. 1 Nr. 2 | |||
| 3.1.1 | - mit Behinderung | § 2 Abs. 2 | 20 € |
| § 1 Abs. 2 | |||
| § 49 Abs. 1 Nr. 1, 2 | |||
| 3.2 | des rechten Fahrstreifens (außer auf Autobahnen | § 2 Abs. 2 | 20 € |
| oder Kraftfahrstraßen) und dadurch einen anderen behindert | § 1 Abs. 2 | ||
| § 49 Abs. 1 Nr. 1, 2 | |||
| 3.3 | der rechten Fahrbahn bei zwei getrennten Fahrbahnen | § 2 Abs. 2 | 25 € |
| § 49 Abs. 1 Nr. 2 | |||
| 3.3.1 | - mit Gefährdung | § 2 Abs. 2 | 35 € |
| § 1 Abs. 2 | |||
| § 49 Abs. 1 Nr. 1, 2 | |||
| 3.4 | eines markierten Schutzstreifens als Radfahrer | § 2 Abs. 2 | 10 € |
| § 49 Abs. 1 Nr. 2 | . | ||
| 3.4.1 | - mit Behinderung | § 2 Abs. 2 | 15 € |
| § 1 Abs. 2 | |||
| § 49 Abs. 1 Nr. 1, 2 | |||
| 3.4.2 | - mit Gefährdung | 20 € | |
| 3.4.3 | - mit Sachbeschädigung | 25 € | |
| 4 | Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen | § 2 Abs. 2 | |
| § 1 Abs. 2 | |||
| § 49 Abs. 1 Nr. 1, 2 | |||
| 4.1 | bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und dadurch einen anderen gefährdet | 40 € | |
| 4.2 | auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen und dadurch einen anderen behindert | 40 € |
Haben Sie Fragen zum Bussgeldkatalog, lassen Sie sich ein kostenloses, individuelles Angebot zur schriftlichen Ausarbeitung Ihrer Anfrage zusenden. Sie erhalten für Sie kostenlos ein Angebot zum Preis, Umfang und Dauer der Bearbeitung. Rechtsanwalt Verkehrsrecht
Mögliche Messfehler bei JVC/Piller CG-P50E
Der Sachverständige Stephan Wietschorke hat einen möglichen Fehler bei Messungen mit dem Messgerät JVC/Piller CG-P50E entdeckt.
Der Zeichengeneratot JVC/Piller CG-P50E wird in vielen Abstandsmessverfahren als "Uhr" zur Zeiteinblendung verwendet.
In einem Versuch des Herrn Wietschorke hat dieser den Zeichengeneratot des JVC/Piller CG-P50E mit der amerikanischen Videonorm (NTSC) aufegzeichnet. Dabei hat er drei Stoppuhren im Sichtfeld der Videokamera aufgebaut und die Videoaufzeichnung gestartet. Der Zeichengeneratot des JVC/Piller CG-P50E hat dabei einen Zeitstempel im Bild eingeblendet. So konnten die Stoppuhren und die "Uhr" des JVC/Piller CG-P50E verglichen werden.
Die Aufzeichnung bestätigte, dass der Zeitgeber des JVC/Piller CG-P50E nicht als Uhr arbeitete, sondern an die Anzahl der Bilder ausgerichtet ist. Die "Uhr" zählt nur die Halbbilder und blendet entsprechend die "Zeit" ein.
Eine Fehlerdifferenz von ca. 4% ist damit wahrscheinlich. Da die "Uhr" des JVC/Piller CG-P50E damit niocht als wirkliche Uhr von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) abgenommen ist, kann keine gültige Messung nach der Eichung die das Eichgesetzt verlangt, vorliegen.
Bei dem Versuch kam es sogar zu Abweichungen von bis zu 20 %. Die Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) wurde aufgefordert, die Zulassung des CG P50 E zurück zu ziehen.
Haben Sie eine Frage zum Messverfahren? Wurden Sie mit dem JVC/Piller CG-p50E bei einem Abstandsverstoß gemessen? Wollen Sie, dass wir Ihnen helfen? Dann lassen Sie sich ein kostenloses, individuelles Angebot zur schriftlichen Ausarbeitung Ihrer Anfrage zusenden. Sie erhalten für Sie kostenlos ein Angebot zum Preis, Umfang und Dauer der Bearbeitung von einem Fachanwalt für Verkehrsrecht. Klicken Sie hier!
12. Nebentätigkeit
Arbeitsverträge enthalten grundsätzlich Klauseln zu Nebentätigkeiten. Hat der Arbeitnehmer bereits eine Nebentätigkeit ausgeübt, sei es eine Vortragstätigkeit oder aber eine eigene selbstständige Tätigkeit, so ist diese bei einem Vollzeitarbeitsverhältnis nur zulässig, wenn es entsprechend im Arbeitsvertrag geregelt ist. Die gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, dass der Arbeitnehmer seine volle Arbeitskraft dem Arbeitgeber zur Verfügung stellen muss. Arbeitsverträge regeln die Frage der Nebentätigkeit regelmäßig dahingehend, dass die Zustimmung des Arbeitgebers für die Nebentätigkeit eingeholt werden muss. Dies ist auch erforderlich um etwaige Konkurrenztätigkeiten des Arbeitnehmers auszuschließen.
Allerdings kann es auch für den Arbeitnehmer einklagbaren Anspruch auf Ausübung einer Nebentätigkeit geben, wenn diese die Tätigkeit beim Arbeitgeber nicht beeinträchtigt und der Arbeitnehmer weiterhin in der Lage ist, seine Pflichten gegenüber dem Arbeitgeber vollständig zu erfüllen. Hierzu zählt auch die Verpflichtung keine Konkurrenztätigkeiten zu übernehmen.
weitere Informationen zum Arbeitsvertrag finden Sie hier:
13. Pfändungsklauseln, Abtretungsverbote
Haben Sie Fragen zum Arbeitsrecht, zur Kündigung oder zum Arbeitsvertrag? Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot erstellen. Klicken Sie hier!
Haben Sie Fragen zu Einkommensteuersätze? Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot zu Ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung erstellen. Klicken Sie bitte hier.
Einkommensteuersätze, Einkommensteuer und Steuersatz
Die Höhe der individuellen Einkommensteuer richtet sich nach dem Einkommensteuersatz bzw. entsprechende dem gesetzlichen Begriff, dem Einkommensteuertarif. Der persönliche Einkommensteuersatz wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. So ist zunächst die Einkommenshöhe entscheidend, da die Einkommensteuer progressiv erhoben wird, also mit steigendem Einkommen höher wird.
Der Einkommensteuertarif richtet sich entsprechend § 32a EStG nach dem zu versteuernden Einkommen. Dieses ist nicht mit dem Einkommen gleichzusetzen, da das zu versteuernde Einkommen erst nach der Berücksichtigung diverser Abzugspositionen wie Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belastungen ermittelt wird.
Das Gesetz bestimmt den Einkommensteuertarif in § 32 a EStG, der bereits die Berechnungsformel für die Ermittlung der Einkommensteuer bereitstellt. Die Berechnungsformel berücksichtigt die Progression in fünf Schritten:
- 0 EUR bis 7.664 EUR,
- 7.665 EUR bis 12.739 EUR,
- 12.740 EUR bis 52.151 EUR
- 52.152 EUR bis 250.000 EUR
- über 250.000 EUR.
Entscheidend zur Bestimmung des persönlichen Einkommensteuertarifes ist auch, ob der Steuerpflichtige Ledig oder Alleinerziehend ist und damit nach der sogenannten getrennten Veranlagung zur Steuer herangezogen wird; für Geschiedene, Getrenntlebende oder Verwitwete gelten die Sätze gleichermaßen; oder ob der sogenannte Splittingtarif gilt, der für Verheiratete anwendbar ist.
Das Gesetz bestimmt den Einkommensteuersatz wie folgt:
§ 32a EStG - Einkommensteuertarif
(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen
1.
bis 7.664 Euro (Grundfreibetrag):
0;
2.
von 7.665 Euro bis 12.739 Euro:
(883,74 * y + 1.500) * y;
3.
von 12.740 Euro bis 52.151 Euro:
(228,74 * z + 2.397) * z + 989;
4.
von 52.152 Euro bis 250.000 Euro:
0,42 * x – 7.914;
5.
von 250.001 Euro an:
0,45 * x – 15.414.
"y" ist ein Zehntausendstel des 7.664 Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. "z" ist ein Zehntausendstel des 12 739 Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. "x" ist das auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag abzurunden.
(2) bis (4) (weggefallen)
(5) Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c das Zweifache des Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkommens nach Absatz 1 ergibt (Splitting-Verfahren).
(6) Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzuwenden zur Berechnung der tariflichen Einkommensteuer für das zu versteuernde Einkommen
1.
bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den Veranlagungszeitraum, der dem Kalenderjahr folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist, wenn der Steuerpflichtige und sein verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllt haben,
2.
bei einem Steuerpflichtigen, dessen Ehe in dem Kalenderjahr, in dem er sein Einkommen bezogen hat, aufgelöst worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr
a)
der Steuerpflichtige und sein bisheriger Ehegatte die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllt haben,
b)
der bisherige Ehegatte wieder geheiratet hat und
c)
der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehegatte ebenfalls die Voraussetzungen des § 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllen.
Dies gilt nicht, wenn eine Ehe durch Tod aufgelöst worden ist und die Ehegatten der neuen Ehe die besondere Veranlagung nach § 26c wählen.
Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 1 ist, dass der Steuerpflichtige nicht nach den §§ 26, 26a getrennt zur Einkommensteuer veranlagt wird.
Einfacher ist allerdings ein Blick in die hier bereitgestellten Steuertabellen, in denen wir Ihnen schon einen groben Überblick geben.
Haben Sie Fragen zur Einkommensteuererklärung? Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot zu Ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung erstellen. Klicken Sie bitte hier.
13. Pfändungsklauseln, Abtretungsverbot
Häufig sehen Arbeitsverträge das Verbot der Abtretung des Arbeitsentgeltes vor. Die Abtretungsverbote haben zumindest bis zur Pfändungsfreigrenze keine Wirksamkeit. Abtretungsverbote können zudem Gehaltspfändungen nicht unterbinden. Im Falle von Gehaltspfändungen sehen viele Arbeitsverträge vor, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Umkosten für die Bearbeitung der Gehaltspfändung erstatten muss. Diese Umkosten bestehen unter anderem in Mehrarbeit und ggf. der Überprüfung der Gehaltspfändung durch einen juristisch erfahrenen Mitarbeiter oder durch einen Rechtsanwalt. Aus diesem Grund können angemessene Kostenpauschalen auch vereinbart werden.
Haben Sie Fragen zum Arbeitsrecht, zur Kündigung oder zum Arbeitsvertrag? Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot erstellen. Klicken Sie hier!